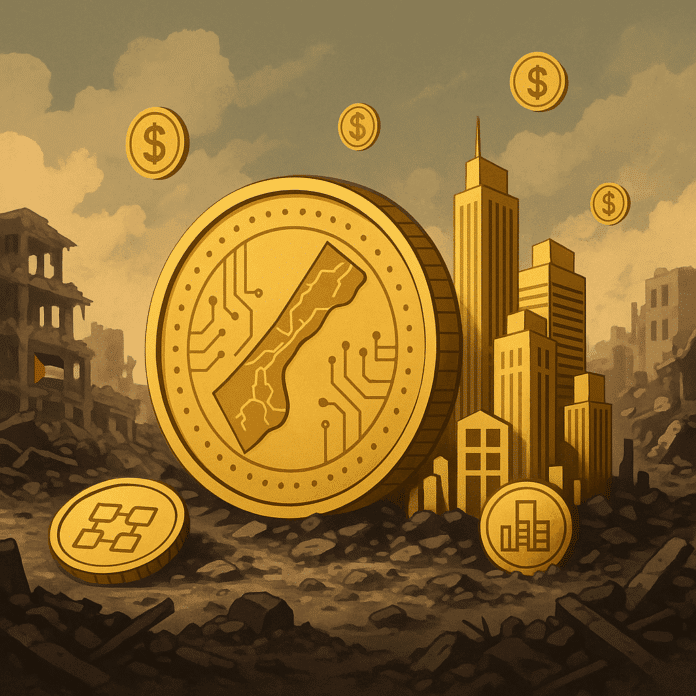
Ein Plan mit weitreichenden Folgen sorgt für internationale Diskussionen: Laut einem Bericht der Washington Post existiert innerhalb der Trump-Administration ein 38-seitiges Konzept, das den Gazastreifen nach dem Krieg neu strukturieren will, und zwar unter direkter US-Verwaltung für mindestens zehn Jahre. Die Initiative mit dem Namen Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (kurz: GREAT Trust) sieht vor, Landrechte palästinensischer Bewohner über digitale Token abzubilden und diese für Umsiedlungen zu nutzen.
Der Clou des Plans: Wer sein Land freiwillig abtritt und Gaza verlässt, erhält einen Token, der später gegen eine Wohnung in einer der geplanten acht „Smart Cities“ oder gegen Bargeld eingetauscht werden kann. Zusätzlich sollen Ausreisewillige 5.000 US-Dollar, vier Jahre Mietzuschüsse und ein Jahr Lebensmittelhilfe erhalten. Während der Plan als „innovatives Finanzierungsmodell“ beworben wird, regt sich scharfe Kritik von Menschenrechtsorganisationen, die von digitalem Landraub und völkerrechtswidriger Praxis sprechen.
Tokenisierung als Investorenmodell
Herzstück des Konzepts ist die vollständige Tokenisierung der Region Gaza. Das bedeutet, dass Landparzellen in digitale Token umgewandelt werden, die Investoren mit der Aussicht auf finanzielle Rendite erwerben können. Die Blockchain-Technologie dient dabei als öffentlich einsehbares Register, das Eigentumsverhältnisse transparent dokumentieren soll. Die Token sind auf Sekundärmärkten handelbar, wodurch sich auch spekulative Chancen für Krypto-Anleger ergeben.
Die Einnahmen aus dem Token-Verkauf sollen in den Wiederaufbau sowie in einen neu geschaffenen palästinensischen Staatsfonds fließen. Allerdings enthalten die Planungsunterlagen auch eine brisante Rechnung: Je mehr Palästinenser das Gebiet verlassen, desto profitabler werde das Modell. Die Umsiedlung koste rund 23.000 US-Dollar weniger pro Person als der Bau neuer Infrastruktur vor Ort.
Smart Cities, Mega-Projekte und geopolitische Interessen
Gaza soll laut Plan in eine Hightech-Zone verwandelt werden, die als humanitäres Vorzeigeprojekt und als wirtschaftlicher Motor mit „Riviera“-Ambitionen dienen soll. Sechs bis acht moderne Städte mit KI-gestützter Verwaltung, digitale Identitätssysteme, eine Industriezone und sogar künstliche Resort-Inseln sind Teil der Vision. Weitere geplante Großprojekte umfassen Datenzentren, Energieinfrastruktur und einen „Abrahamischen Korridor“ zur Vernetzung mit Israel, Ägypten und dem Golfraum.
Finanziert werden soll dies durch eine Kombination aus staatlichen Zuschüssen und privatem Kapital. Die Projektinitiatoren sehen darin eine Win-win-Situation für Geopolitik, Investoren und eine angeblich freiwillige Bevölkerung.
Empörung und Ablehnung aus der Region
Während sich das Weiße Haus zu dem Prospekt bislang nicht offiziell äußerte, wurden mehrere zentrale Figuren aus Trumps Umfeld mit dem Projekt in Verbindung gebracht, darunter Jared Kushner, Marco Rubio und Steve Witkoff. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu lobte den Plan als „mutige Vision“. Dagegen stoßen die Inhalte bei der palästinensischen Bevölkerung auf Ablehnung. Viele Bewohner weigern sich, ihre Heimat aufzugeben, selbst wenn diese nur noch aus Ruinen besteht.
Bürgerrechtsorganisationen wie der Council on American-Islamic Relations gehen noch weiter: Sie warnen vor einer algorithmischen Enteignung im großen Stil. Die Verwendung von Blockchain-Technologie zur Legitimation von Vertreibung sei moralisch bedenklich und könne nach internationalem Recht als Kriegsverbrechen gewertet werden. Der Vorwurf: Hier werde Technologie zur Entwurzelung und Privatisierung ganzer Bevölkerungsgruppen missbraucht.
